|
|
|
|
|
|
|
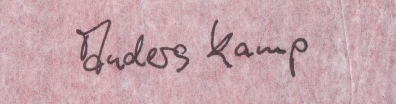
|
Theater ohne Publikum. Erfahrungsbericht aus Stendal
„Der nicht arbeiten kann, der kann nicht leben“
(Aus „Mendel Scheinfelds zweite Reise nach Deutschland“)
1 Ersterbendes Urbanes in Zentralrepublikanien
Steigt man in Stendal aus dem Zug, was die wenigsten einfach so, zur touristischen Erkundung und immer weniger zum Arbeiten tun, hat man den Eindruck, hier täte sich was. Es wird gebaut, Häuser werden renoviert oder Einzelhandelskaufleute richten Läden ein. Und man sieht, es ist notwendig, Verfall und Leerstand ist an jeder Ecke erkennbar.
Steigt man einen Monat später mal wieder aus, um wieder zur Arbeit zu gehen, bekommt man langsam den richtigen Eindruck, hier täte sich nicht genug. Der oder ein anderer Einzelhändler räumt den Laden wieder, die Fachwerkbaustelle hat sich nicht verändert. Wahlplakate hängen mit verblassenden Farben bis lange nach der Wahl, wenigstens die Abrißbirne schwingt in einige der ungeliebten Platten in Süd oder Stadtsee, ein Viertel am damals vom Reichsarbeitsdienst ausgehobenen, einst nach dem Führer benannten Tümpel, dessen Reinigung die Stadt nicht mehr tragen kann. Einmal im Jahr feiern die Skins beschaulich und unbehelligt mit Sieg-Heil-Rufen. Man erzählt sich, daß es hier früher Bootsvermietung und Seeterrassen gegeben hätte. Vor meiner Zeit.
Die Bahn hat hier eine Lokomotivwerkstatt, einzigartig in Deutschland. In den letzten Jahren sind hier über 7000 Arbeitsplätze abgebaut worden - sozialverträglich.
Stendal sei ein Verkehrsknotenpunkt, hört man, eine Autobahnanbindung und ein Flughafen sollen kommen, sogar der ICE hält hier manchmal. So kommt man wenigstens gut weg, denn, wer kann zieht weg. Wer bleibt, naja, sieht fern. Von Tatendrang keine Spur. Stendaler sind geübt in Nörgeln und Resignieren.
Das Lied, welches im Theaterjugendklub immer voll lautester Inbrunst mitgesungen wurde, kommt von der Gruppe Keimzeit: Ganz weit weg, so weit wie möglich...
2 Spielen an der äußersten Peripherie öffentlicher Wahrnehmung
Früher mußten die Leute betriebskollektiv ins Theater. Das nehmen sie ihm heute noch übel und kommen nur, wenn Oper läuft, dreimal im Jahr und, na gut, zu den Klassikerpremieren. Wir fingen an als Ensemble mit neun Anfängern von 20 Schauspielern, voller Schneid und Elan, wollten was bewegen und gutes aufregendes Theater machen. Schon nach kurzer Zeit gaben die Ersten auf: Die Stadt wäre langweilig, die Leute fürchterlich, der Intendant unbeweglich, die Inszenierungen öd und schlecht, die Gewerke machten Dienst nach Vorschrift, Berlin wäre gottseidank so nah und wir müßten doch mal was machen! fand keine gemeinsame Verknüpfung, bzw. brauchte sehr viel Alkohol oder Zeit, die es neben dem Abstecherbetrieb nicht gäbe. Die Stadt bekäme eben das Theater, das sie verdiene. Erst gegen Ende unserer gemeinsamen Zeit fanden wir differenziertere Betrachtungen, doch da ging uns die Zeit nun wirklich aus. Was genau hatte diesem Ensemble den Zahn gezogen?
Zunächst inszenierte der Intendant „Romeo und Julia“, während Frau W. „Familiengeschichten.Belgrad“bearbeitete, beides waren gelinde Katastrophen. Der Intendant ging routiniert und desinteressiert vor, die W. schlicht planlos, zudem wollte es tatsächlich niemand sehen, wir kamen auf elf Vorstellungen mit im Schnitt 15-20 Zuschauern. Die Presse verriss, auf den Fluren hieß es, der Intendant ließe verlautbaren, er könne da nichts tun und mit der schauspielerischen Qualität, die er an sein Landestheater binden könne, sei es eben nicht weit her.
Dann wurden wir als Tourneeweihnachtstheater mit "Die Bremer Stadtmusikanten" geschliffen, der inszenierende Intendant hatte sich kaum regeneriert, die titelgebenden Tiere kamen kaum vor. Anfang Dezember waren einige von uns von verdorbenen Bühnenwürstchen fleischvergiftet worden, die Requisite hatte Anfang Oktober eine Großpackung geordert, die Räuber waren erleichtert, vor dem Essen von den Tieren aus Bremen verjagt worden zu sein.
56 Vorstellungen in 40 Tagen, die erste um acht , die zweite um halb elf, abends Probe, Ende Dezember Premiere von „Bye, Bye Andrea Doria“, einer Revue mit dem Originalpianisten der MS Völkerfreundschaft und vorher-nachher Anekdoten heute arbeitsloser, damaliger Helden der Arbeit, was ein Spaß hätte sein können, wenn die übermüdeten und allesamt grippekranken Darsteller davon etwas hätten merken können. Der Chef sprach von Arbeitsverweigerung und mochte Andrea Doria auch sonst nicht, also versickerte das DDR-Traumschiff ohne Ankündigung einer letzten Vorstellung.
Ohnehin fielen die schönsten Vorstellungen in bester Regelmäßigkeit aus, die vier Treuen, die zum „Messias“ kamen, schickten wir nach Hause, die fünfe bei „JazzLyrikProsa“ ebenso und so weiter. Als die SPD-Kreistagsfraktion zur Vorstellung kam, verkündete sie vorher, daß man über ein Bespieltheater nachdenken müsse, so ein Ensemble würde sich doch nicht lohnen. Über die Sozialistenwitze des Tucholsky mochten sie dann auch nicht lachen.
Der Kultusminister des Landes Sachsen-Anhalt, der zur feierlichen Vertragsunterzeichnung kam, sprach vom Theater südlich der A4. Oder so. Ich hab´s vergessen, es ging um Autobahnen, wir schenkten dazu Sekt aus. Rotkäppchen. Der Vertrag regelte die Finanzierung bis zum Jahr 2005, so lange der Intendantenvertrag eben währte. Die Arbeitsgrundlage war also geregelt. Danach wurden Häppchen gereicht. Eine Delegation von uns wurde zum Singen gezwungen.
Nach einem Dreivierteljahr verließ uns die Chefdramaturgin, und uns damit die Hoffnung auf Energie und Kreativität aus der oberen Etage. Olgas Inszenierungen waren die Lichtblicke im Stendaler Schauspielerdasein, genreübergreifend beherztes, modernes und verrücktes Theater, Uraufführungen gar, was wohl nicht in diese Provinz passen wollte. Es gab Preise und Einladungen nach Potsdam und Linz und leere Sitzreihen daheim. Ihr „Paul und Paula“, war allerdings ein Erfolg, verband es doch Ostalgie mit einem heutigen Blick, traf den Nerv des heimeligen Altbekannten und den regionalen Galgenhumor, wenn etwa ein Monolog der Frau mit dem Kinderwagen über die Plattenbauten, die alles Geld der DDR verschlängen, mit einer Videoprojektion der oben bereits erwähnten einschlagenden Abrißbirne kontrastiert wurde. Das war seltenes großes Theater. Es war sogar meistens fast halb voll.
Sonst konnten wir uns nur gewiß sein, daß die Kinder- und Jugendstücke immer verkauft wurden, wie wir etwa die Geschichte von „Ben liebt Anna“, über die erste Liebe (ab 12), für Berufsschulklassen spielten: Ausziehn! Ausziehn!
Der Alkohol- und Drogenkonsum im Ensemble nahm stetig zu.
3 Lustvoll Scheitern, nicht sang- und klanglos
 Für den Welttheatertag 2001 hatten wir uns etwas Subversives ausgedacht: Wir wollten in der Fußgängerzone für die Schließung aller Theater in Deutschland demonstrieren, unsere Argumente auf Flugblättern waren: es gäbe keine Werbepausen, es wäre langweilig oder man müsse dabei nachdenken, wenn es doch eh keine Arbeitsplätze gäbe, wären Theaterleute denn etwas besseres und andere humorige Dinge. Dazu hatten wir eine Los-Tombola aufgebaut, an der willige Bürger ein Theater ziehen durften, das wir an Ort und Stelle von seiner Schließung benachrichtigten und auf einer Deutschlandkarte abzeichneten. Der Intendant untersagte es. Wir nahmen alle Urlaub. Selbst das Theater der Altmark Stendal wurde an diesem Tag in der Fußgängerzone von einem anderen ehemaligen Intendanten gezogen und geschlossen.
Für den Welttheatertag 2001 hatten wir uns etwas Subversives ausgedacht: Wir wollten in der Fußgängerzone für die Schließung aller Theater in Deutschland demonstrieren, unsere Argumente auf Flugblättern waren: es gäbe keine Werbepausen, es wäre langweilig oder man müsse dabei nachdenken, wenn es doch eh keine Arbeitsplätze gäbe, wären Theaterleute denn etwas besseres und andere humorige Dinge. Dazu hatten wir eine Los-Tombola aufgebaut, an der willige Bürger ein Theater ziehen durften, das wir an Ort und Stelle von seiner Schließung benachrichtigten und auf einer Deutschlandkarte abzeichneten. Der Intendant untersagte es. Wir nahmen alle Urlaub. Selbst das Theater der Altmark Stendal wurde an diesem Tag in der Fußgängerzone von einem anderen ehemaligen Intendanten gezogen und geschlossen.
2003